Auch wenn es nun schon ein paar Tage her ist, soll der Abend doch noch bloggenderweise festgehalten werden: Die Rede ist von der „langen Nacht der Vampirfilme“, die am 21. November in der ARGE stieg. Eröffnung: NOSFERATU, die Murnau-Version, mit Live-Begleitung eines Salzburger Kammerorchesters! Zack! Danach: Weitere 4 Vampirfilme bis in die frühen Morgenstunden! Zack!
Hauptattraktion war somit natürlich die NOSFERATU-Aufführung. Nicht nur, daß ich den Film nie gesehen hatte (gewisse Bilder und Szenen waren mir geläufig) – wann hat man denn auch schon die Gelegenheit, den Film mit Live-Musik zu erleben? Vorgestellt habe ich mir ja so ein kleines 4-Mann-Streichquartett („Haben Sie schon einmal etwas von Beethoven gehört? Brahms? Bismarck?“), aufgetreten ist ein 13-köpfiges Orchester plus Taktstockwedler. Das gibt so einer Aufführung natürlich eine ordentliche Präsenz: Gegen den Raumklang und die Wucht, mit der besonders die dramatischen Passagen untermalt waren, stanken die nachfolgenden, von der DVD abgespielten Filme natürlich arg ab.

Auch abseits der greifbaren „Anwesenheit“ des Films war es spannend, sich Murnaus Klassiker zu widmen. Natürlich ist es völlig unmöglich, den Film so zu sehen, wie er 1922 gewirkt haben muß: Damals haben sich die Leute immens gefürchtet und hatten direkt körperliche Reaktionen auf den Streifen (ähnlich wie Menschen später z.B. bei DER EXORZIST oder DER WEISSE HAI reagiert haben). Heutzutage sind wir nicht nur von der fortschreitenden Technik ganz andere Schock- und Gruseldarstellungen gewohnt, das ganze Filmerlebnis ist ja mittlerweile ein viel allumfassenderes – die Kamera ist mittlerweile so viel dichter im Geschehen, die Darstellung ist realistischer, die Synthese aus Bild, Musik, Schnitt hat einen viel stärkeren Effekt auf den Seher.

So kann man also nur versuchen, sich in der Zeit zurückzudenken, und den Film für seine ästhetischen und künstlerischen Aspekte schätzen: Das unsterbliche Bild des Orloc, wie er sich aus seinem Sarg erhebt; oder der Schatten, den er an die Wand wirft, als er die Stiege hinaufgeht. Murnau und sein Kameramann Fritz Arno Wagner schaffen sogar einige Stop-Motion-Effekte. Am beeindruckendsten ist aber immer noch Max Schreck: Wo andere Stummfilmdarsteller gestikulieren und grimmassieren, wie es zur damaligen Zeit üblich war – da hat der Stummfilm eben seine Wurzeln immer noch so stark im Theater und muß zusätzlich mit der Reduktion des Klangs leben – ist Schrecks Graf Orloc eine völlig überzeugende Darstellung. Sie ist – sagen wir einmal: lückenlos. Wir sehen kein Spiel. Wir sehen nur eine unheimliche Kreatur. Kein Wunder, daß Elias Merhige irgendwann die reizvolle Phantasie sponn, daß Schreck nicht etwa die Rolle besonders intensiv verkörpert, sondern tatsächlich ein Vampir sei (SHADOW OF THE VAMPIRE ist ein exzellentes Begleitstück zu diesem Film).
Und obwohl selbst die begeistertsten Cineasten bei der Aufführung immer wieder angenehm amüsiert waren über die fast prähistorischen Effekte und die Inszenierung (als würde man ein Modem mit Akustikkoppler betrachten – fasziniert und doch ein wenig belustigt, wie sehr sich doch nicht nur die Technik, sondern auch wir im Umgang damit entwickelt haben), so bleibt ein Film wie NOSFERATU doch immer auch eine lohnenswerte Erfahrung: Nicht nur, daß es ein Stück Filmgeschichte ist und daß die Kreativität Murnaus und seiner Leute immer noch reizvoll bleibt – man kann auch immer noch daraus lernen (wie aus den meisten anderen Stummfilmen), wie Geschichten über Bilder erzählt werden: Denn Bilder waren das Hauptmittel, das diesen Filmemachern zur Verfügung stand. Dialoge sollten vermieden werden – wer liest sich schon gerne einen Wolf? (In seinem Film DER LETZTE MANN verzichtete Murnau 1924 komplett auf Zwischentafeln!) – und die Schauspieler bauen mehr darauf, eine Idee zu vermitteln als eine realistische Darstellung. Was bleibt, sind die Bilder: Was wird gezeigt, wohin wird geschnitten, wie werden Ideen, Stimmungen, Konzepte über das Bild an sich verkauft. (Angeblich ist NOSFERATU einer der ersten Filme mit Parallelmontagen.)
Nach so viel Kultur und ernsthafter Filmkunst wirkt der nächste Film im Programm – per Videobeamer und DVD abgespielt – fast noch antiquierter und amüsanter: DRACULA von 1958 – der Film, der Christopher Lee auf ewige Zeiten mit dem Namen Dracula verknüpfte. Aber auch hier muß man sich wieder in die Zeit zurückbegeben, in der der Film entstanden ist: Die erste Welle der klassischen Horrorfilme lag mittlerweile über 20 Jahre zurück (Universals DRACULA mit Bela Lugosi erschien 1931) und war schon in den 40ern in die Parodie gekippt (wie es ein Genre immer macht, wenn es überstrapaziert wurde – siehe den jetzigen Release von ZOMBIELAND). Danach waren die realen Ängste der Atombombe und des Kalten Krieges angesagt: Die Horrorfilme der 50er zeigten von radioaktiver Strahlung mutierte Insekten, die die Menschheit vernichteten, und identitätsraubende Wesen, die uns unterwandern (klar: der Kommunismus). Der vom britischen Hammer-Studio produzierte DRACULA war somit also wieder eine völlige Wende – und es war das erste Mal, daß die Vampirgeschichte in kräftigen Farben erzählt wurde (man beachte nicht nur die farbenfrohe Ausstattung, sondern auch das immens rote Blut!). Zusätzlich waren die sexuellen Implikationen der Geschichte – ein Mann schleicht sich in die Schlafzimmer junger Damen hinein und bringt sie durch den Biß in den Hals in einen Hörig- und Abhängigkeitszustand – stärker als zuvor erzählt, und mit dem Abhängigkeitselement kam auch noch die Implikation von Drogeneffekten hinzu.

Und natürlich wird auch Lees Dracula heute eher mit distanziertem Auge betrachtet: Wie betont dramatisch die Musik die ganze Zeit dröhnt! Wie auffällig doch alle Locations Studiosets sind! Wie unklug sich doch die Figuren verhalten (Harker, der hier schon mit der Absicht, Dracula zu töten, zum Schloß kommt, zieht es vor, zunächst einer Vampirfrau einen Pflock durchs Herz zu rammen, und erlaubt es Dracula somit, wach zu werden), und wie sehr sie sich doch in den Rollenvorstellungen der damaligen Zeit verhalten (nüchterne Männer, die den schwachen, emotionalen Frauen die starke Schulter bieten!). Ich erinnere mich, wie mich als Kind gerade das Finale, in dem Dracula mit Sonnenstrahlen und einem mit zwei Kerzenständern geformten Kreuz vernichtet wird und langsam zu Staub zerfällt, wirklich verängstigte – heutzutage sieht man da eher, wie die Effekte gemacht wurden, und ist dank des gemächlichen Erzähltempos eh schon lange bereit, dem Blutsauger Lebewohl zu sagen.

Trotzdem möchte ich kurz auf meine Lieblingssequenz des Films hinweisen: Harker ist in Draculas Schloß, und die besagte Vampirfrau ist kurz davor, sich an Harkers Hals schaffen zu machen (er hielt sie für eine normale Frau und umarmt sie gerade tröstend). Plötzlich wird die Tür aufgerissen, und Dracula steht mit Blutspuren um den Mund im Zimmer und stürzt sich auf die Frau – derselbe Mann, den wir gerade vorher noch als gutaussehenden, zurückhaltenden Aristokraten gesehen haben. Bemerkenswert ist der Schnitt dabei: Terence Fischer, der Regisseur, schneidet sofort in eine Nahaufnahme von Lee, bevor er dann herausspringt und zeigt, was passiert. Selbst heute hat es noch eine kleine Schreckwirkung, wie schnell und unvermittelt wir so nah an dieser Fratze dran sind.
Nach den beiden Filmen verabschiedeten sich der junge Eleve Peter sowie der noch jüngere Kollege Andi B., um wie anständige Menschen rechtzeitig ins Bett zu kommen (wie bürgerlich! Pah!). Nur Hasi blieb, um auch dem dritten Film beizuwohnen: Einem mir bislang unbekannten Film namens VAMPYRES (auch als DAUGHTERS OF DRACULA erschienen) von 1974, Regie: José Ramón Larraz. Der Film ist bei uns nie erschienen und bedient ein Subgenre, das gerade in den Siebzigern sehr beliebt war: Die erotische Vampirgeschichte. Genauer gesagt: Lesbische Vampire. Da wird also nicht nur an Hälsen gesaugt.
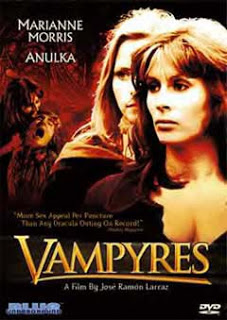
Stars gab es in diesen Filmen natürlich nie wirklich, stattdessen spielen also zwei Mädels, die hauptsächlich wegen ihrer äußeren Qualitäten besetzt wurden (als wäre das bei anderen Filmen nicht so!): Marianne Morris und ein Model namens Anulka. Es geht also um zwei vampireske Mädels, die auf einem alten englischen Landsitz hausen und beständig Anhalter verführen, um sie dann zuhause nach dem Liebesspiel auch wortwörtlicher zu vernaschen. Und so wird flugs eine Reihe von Figuren eingeführt, die über kurz oder lang dort im Haus landen – darunter auch ein Kerl, der Marianne Morris so gut gefällt, daß sie ihn nicht beißen will, sondern lieber als Liebessklaven behält. Der arme Kerl wird natürlich nicht nur sexuell abhängig (da haben wir’s wieder!), sondern auch körperlich immer kraftloser. Klingt ein wenig trashig? Ist es auch.

Freilich treibt der Film (bzw. das ganze Subgenre tat es) nur die schon in der Vorlage angelegten Elemente auf eine sehr explizite Spitze, wie sie eben in den Siebzigern mit dem Aufkommen der Pornographie, dem generell viel lockereren Umgang mit Sex, und dem durch die Gegenkultur erkämpften Gefühl, frei heraus alles sagen und zeigen zu können – falsch: zu müssen! – eine ganz logische Konsequenz war. Somit ist VAMPYRES auch wieder sehr interessant: Nicht nur, daß die erotischen Implikationen der Geschichte hier viel stärker wiegen als irgendein Plot – es wird damit die Verbindung von Sexualität und Tod viel deutlicher gezeichnet (immerhin war diese Verbindung zur viktorianischen Zeit, als Bram Stokers Buch erschien, auch als Warnung oder als Zuspitzung des Zeitgeistes zu lesen: Die Verführung bringt einen ins Verderben). Darüber hinaus ist die Rollenumkehrung spannend: Hier gibt es keine starken Männer und hilflose Frauen wie noch 1958 – hier müssen die triebgesteuerten Männer vor den Frauen Angst haben, die ihre Sexualität als Waffe einsetzen (mehr zu diesem Thema in diversen Filmen von Paul Verhoeven).
Und ja, der Softcore-Grusel-Mix ist durchaus gelungen. Kamera und Ausstattung sind ansprechend und stimmungsvoll, der Film hat eine Sogwirkung, und der Verzicht auf einen straffen Plot verstärkt die etwas unwirkliche Atmosphäre, in der man nicht genau weiß, was jetzt kommen mag. Alleine die Bilder – Schatten, düster ausgeleuchtete verwinkelte Gänge, ständig hat man das Gefühl, nicht genug vom Raum zu sehen – geben VAMPYRES einen eigenen Charakter.
Mittlerweile war’s also halb zwei in der Nacht, und die Müdigkeit hatte schon bei VAMPYRES eingesetzt. Hasi verabschiedet sich und hat hoffentlich auf dem Nachhauseweg keine Frauenhälse angeknabbert, ich selbst bin in Entscheidungsnot – bleibe ich, um mir George Romeros MARTIN anzusehen, der mich wirklich interessiert? Oder gebe ich dem ständigen Gähnen nach und gehe heim, wie es jeder vernünftige Mensch tun würde?
Ratet mal.
Mit beständig aufgerissenem Hals und dem Versuch, mich durch dauerndes Umsetzen munter zu halten, habe ich mich also durch den Romero-Film gequält. Wobei man von Quälen ja hier gar nicht reden darf: Der Film ist exzellentes Underground-Kino, eine wirklich interessante moderne Verwebung von Vampir-Motiven, religiösem Eifer und einem tragischen Psychogramm. Was vermutlich auch erklärt, warum ich wach geblieben bin.
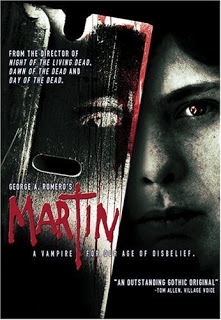
Im Film lernen wir Martin kennen, einen jungen Mann, der schon gleich zu Beginn einer jungen Frau in einem Zug nachstellt. Er bricht in ihr Abteil ein, betäubt sie, schläft dann mit ihr und schneidet ihr die Pulsadern auf, um ihr Blut zu trinken. Dann verschwindet er wieder. Wenig später kehrt Martin zu seiner Wohnmöglichkeit zurück: Er lebt bei einem Onkel, der im religiösen Eifer ihn immer wieder anklagt, Nosferatu zu sein, und der beständig probiert, Martin auf den rechten Weg zu führen und seinen Dämon auszutreiben.
Von Martins nächtlichen Aktivitäten weiß der Onkel aber gar nichts, und es stellt sich die Frage, ob der Onkel vielleicht Recht hat und Martin tatsächlich mit einem Fluch beladen ist – oder ob Martin aufgrund des religiösen Wahns des Onkels vielleicht selbst irgendwann diese Verhaltensmuster entwickelt hat. Die Frage wird nie beantwortet, und man kann sich selbst zusammenreimen, ob der Junge vielleicht einfach nur das tragische Opfer eines Sektenspinners ist, der irgendwann sogar mithilfe eines Exorzisten probiert, ihm den „Nosferatu“ auszutreiben.

MARTIN ist eine absolute Low-Budget-Produktion, aber die grobkörnigen, dreckigen Bilder arbeiten für den Film. Romero spielt mit den althergebrachten Vampir-Bildern: So läuft Martin einmal mit falschen Zähnen und Umhang herum, um sich über seinen Onkel lustig zu machen. Gleichsam aber werden Martins Taten nie effektheischend inszeniert, sondern fast nüchtern, und weil sich der Junge ständig bemüht, seinem Trieb nicht mehr nachgehen zu müssen und eine normale Beziehung zu beginnen, ist er als wirklich spannende tragische Figur gezeichnet.
3.15h nachts ist es am Schluß von MARTIN, und es sitzen nur noch ein paar vereinzelte Filmfreaks im Saal. Der nächste und letzte Film wäre NEAR DARK von Kathryn Bigelow, und ich bin kurz am Überlegen, ob ich mir das auch noch antun soll. Aber dann siegt die Vernunft: Ich kenne den Film, habe ihn auf DVD, und brauche dringend Schlaf.
Am nächsten Tag hab‘ ich dann übrigens den oben erwähnten SHADOW OF THE VAMPIRE gesehen und auch einen Text dazu begonnen – mal sehen, ob der in absehbarer Zeit mal fertig wird …
P.S. Ja, ich habe gemerkt, daß ich mitten im Text die Erzählzeit gewechselt habe.
—————–
4 8 15 16 23 42




