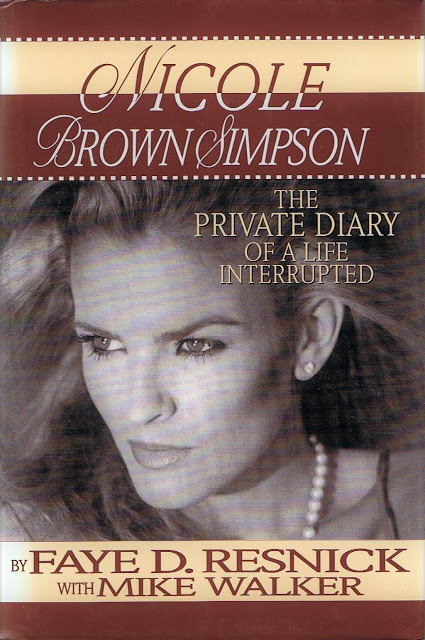Allein das Booklet ist grandios: Da posiert Kate Ryan mit sieben verschiedenen Outfits und einem einzigen Gesichtsausdruck. Auf jedem Bild grinst sie keck den Betrachter an – abgesehen von dem einen Bild, wo nur ihre Beine fotografiert wurden – und trägt dabei mitunter Klamotten, bei denen das Preisschild vermutlich größer war als das erworbene Textil. Alle Bilder, auf denen Käte ernst schaut (und glatte 10 Jahre älter aussieht), sind auf ihrer Homepage zu finden.
Kätilein macht Dance-Pop, und zwar diese Art von Euro-Disco-Techno-Geträller, bei dem flirrende Synths aseptisch durch gleichförmig stampfende Rhythmen wabern. Jeder Song klingt gleich: Das gleiche Tempo, der ewig gleiche Beat, die unendlich langweiligen Keyboards darüber. Und Kate singt dazu simple Melodien rauf und runter. Manchmal auf englisch, aber zur Hälfte auch auf französisch: „Pour quel amour saurais-je un jour“, singt sie dann, was soviel heißt wie „Wer hat den Mais gefuttert“.
Auf ihrer Homepage steht ja nun, daß Kate eine Singer-Songwriterin ist. Jetzt mal abgesehen davon, daß von den 13, räusper, Liedern auf dem Album – immerhin ihr viertes! – nur eines von ihr stammt und sie bei zwei weiteren irgendwas mitgedichtet hat, wähnt man Kate definitiv nicht im Café um die Ecke, wo sie mit der Akustikgitarre Lieder aus dem Leben zum Besten gibt. Wenn Kate Ryan eine Singer-Songwriterin ist, dann sind Pearl Jam Jazz, Manowar machen Disco, und Madonna ist Zwölftonkomponistin. Echt nicht, Kate.
Eigentlich entzieht sich Musik wie diese ja der kritischen Rezeption. Sie ist nämlich nicht für Leute gedacht, die gerne Musik hören. Kate Ryans Beackern des Dancefloors ist funktional ausgerichtet: Der Sound soll nämlich exakt dort funktionieren, wo unter Lichtgeflirre und schwitzendem Auf- und Abhüpfen ohnehin schon egal ist, was da mit viel Rumms auf die Eins wummert. Zum aufmerksamen Anhören ist das richtig grausam, von vorne – ganze Rinderherden stampfen durch das 1:1-Cover von „Voyage, voyage“ und das bemitleidenswerte „Ella Elle l’a“ – bis ganz hinten, wo einfach jeder Song nach dem exakt gleichen Strickmuster abläuft. James Last hat auf fünftausend Alben mit seinem Tanzorchester das gleiche Prinzip verwendet: Ein Rhythmus für 45 Minuten, ein paar Melodien drüber, immer lächeln dabei und ja niemanden überfordern.
Natürlich kann man sich das lang genug anhören, bis es nicht mehr weh tut. Dann findet man auf einmal „We All Belong“ irgendwie ganz lustig, weil die Eurosynths mal Pause machen und Percussion zu hören ist. Aber warum sollte man eigentlich? FREE ist so unterhaltsam wie eine Wurzelbehandlung bei Dr. Alban, und musikalisch gesehen ebenso inspirierend.
„No more pain, just let it be / You’re free now“, trällert Käthe im letzten Lied. Sehr mitfühlend, die Gute.
Dieser Text erschien zuerst bei Fritz/Salzburger Nachrichten.
—————–
4 8 15 16 23 42