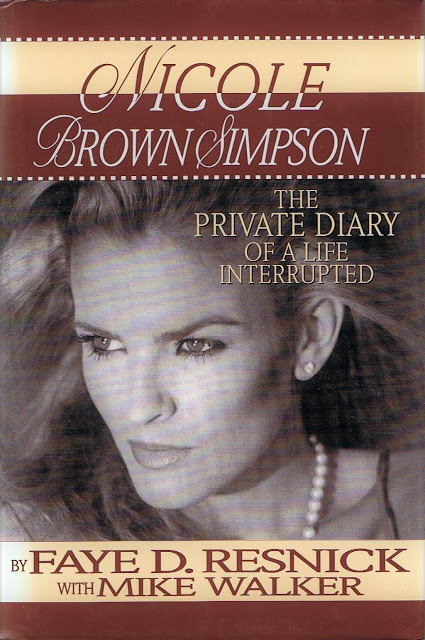Der Ruhm kommt heim
Die Punk-Pop-Truppe New Found Glory und ihr fünftes Album: Wird es Überraschungen geben?
Sieht man mal von der Musik ab, ist der Teen-Pop-Punk, der sich seit den späten Neunzigern in Plattenläden und Highschool-Filmen breitgemacht hat, ein sehr spannendes Phänomen. Die einschlägigen Bands – nur der fanatische Hörer im Durchschnittsalter von ungefähr 15 Jahren vermag sie auch nur annähernd auseinanderzuhalten – bedienen sich prinzipiell desselben musikalischen Duktus wie die britischen Ur-Punks, aber keiner seiner Inhalte, und haben der Musik das Sperrige, das Dagegensein an und für sich genommen und sie so in einen neuen, gesellschaftlich akzeptablen Kontext transferiert. Es geht nicht mehr darum, den bestehenden Verhältnissen möglichst asozial den Mittelfinger ins Gesicht zu halten – vielmehr sind die Dramen des Heranwachsens in einen vermeintlich rebellischen, aber inhärent zahn- und harmlosen Träger gebettet. Punk – früher ein Schimpfwort – ist heute gut, und auch die Maxime der Individualität ist gewichen: Die Teen-Punks klingen alle gleich.
Eine dieser Gruppen – gefühlsmäßig eine der qualitativ besseren, weil beständigen – ist New Found Glory, die mit COMING HOME immerhin schon ihr fünftes Album vorlegt. Auch Berufsteenager werden älter, heiraten, kriegen Kinder, aber diese Lebenserfahrungen müssen sich ja rein inhaltlich nicht zwangsläufig in der Musik niederschlagen. Und so erzählen New Found Glory auch diesmal wieder von den großen und kleinen Dramen des Alltags. Geschichten, in denen sich jeder wiederfinden kann. Das tun sie überraschend unplakativ – hier wird nicht auf Lebenszeit gehaßt, sondern nur eine Trennungszeit ausprobiert. Selbst wenn der Tod Einzug in das Banduniversum hält – „When I Die“ handelt von Gitarrist Chad Gilberts kürzlich verstorbenem Vater – bleibt der Grundtenor versöhnlich: „Now I have finally accepted / We will never stand in the same room“.
Überhaupt nimmt – rein textlich gesehen – das Nachdenkliche dem Stürmischen gegenüber immer öfter Vorrang: „It’s hard to get rejected / By the one you most expected to be by your side“, heißt es schön beobachtet im ersten Song „Oxygen“. „I’m coming home to you again / I hope things haven’t changed“, wird später über eine Beziehung gesungen, die eine Zeitlang auf lange Distanz geführt wurde. New Found Glory sind keine großen Poeten, aber sie schaffen es immer wieder, Stimmungen einzufangen: „I know everything reminds you of me / Even the songs you thought I’d never sing“, versucht Sänger Jordan Pundik eine Freundin in „Make Your Move“ zurückzugewinnen.
Aber lassen wir uns nicht dazu verleiten, großartige Änderungen im musikalischen Kosmos der Band zu verorten: Musikalisch bleibt der altbekannte formattaugliche Power-Pop, viel Gitarren, ein bißchen Punk, aber nie aus dem Rahmen fallend. Jeder Song hat Energie und Melodie, aber natürlich klingen sie alle irgendwo gleich, was einerseits an Pundiks Stimme liegt, die wenig Differenzierung ermöglicht, und andererseits an der Produktion, die über sämtliche Spuren so viel auto-tuning, processing, ProTools-Quantisierungen und weitere Glattbügeleien legt, daß das Resultat immer super druckvoll und völlig identitätslos klingt. Eigentlich könnte jeder Song eine Single sein, und somit dann wieder gar keiner, und nach der Hälfte des Albums ist es eigentlich schon genug. Das liegt nicht an der mangelnden Qualität der späteren Lieder, sondern einfach am Überschuß an Gleichem. Nur der akustische Singalong „Too Good To Be“ weicht von der Formel ab – und das auch nur durch Verzicht auf Verzerrer.
Die Einschränkungen, mit denen dieses Album leben muß, liegen in der Natur der Sache. Im Rahmen ihres Genres liegen New Found Glory sicherlich weit vorne – sie schütteln Melodien aus dem Ärmel und fangen Alltagsgeschichten gekonnt ein. Daß klanglich und musikalisch keine Überraschungen zu erwarten sind, kündigen sie uns ja auch schon durch den Albumtitel an: New Found Glory sind hier zu Hause.
Dieser Text erschien zuerst am 28.9.2006 bei Fritz!/Salzburger Nachrichten.
—————–
4 8 15 16 23 42