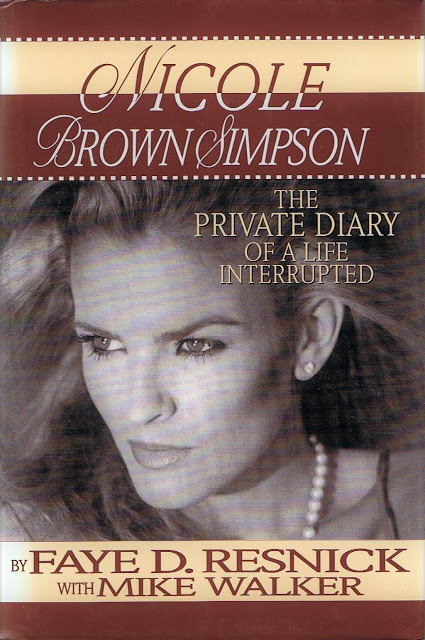Der eine oder andere mag Notiz davon genommen haben: Am Mittwoch, den 24. April 2002, war Ereignistag in Österreich. Um gegen die bevorstehende Universitätsreform, oder genaugenommen gegen das dadurch in Kraft tretende neue Unigesetz, zu protestieren, wurde an diesem Datum ein Streik ausgerufen und die Arbeit niedergelegt. Damit auch jemand den Unterschied zu sonst bemerkt, wurde das kollektive Nichtstun mit einer Demonstration verknüpft, bei der man seinen Unmut kundtun konnte.
Tatsächlich konnte nicht einmal das durch einen vortägigen Regentanz seitens des Ministeriums heraufbeschworene ungemütliche Wetter die Universitätsangehörigen davon abhalten, per Trauermarsch durch Salzburg zu ziehen und sich hier und da zu äußern. Auf den ersten Blick waren das auch recht viele Teilnehmer, die da mitwanderten: 700 Menschen waren zu sehen, sowohl Studenten als auch Mittelbauvertreter und Professoren. Eine enorme Anzahl, wo ich selbst doch eher mit sieben denn mit siebenhundert gerechnet habe.
Nur ist „viel“, wie so manches im Leben, relativ zu verstehen. Verglichen mit der allgemeinen Erwartungshaltung sind 700 Demonstrationsteilnehmer wohl viel, betrachtet man sich dagegen die Zahl der Universitätsangestellten (von den inskribierten Studenten will ich gar nicht anfangen), sieht der sich echauffierende Haufen eher erbärmlich aus. An der Salzburger Universität gibt es über 1000 Angestellte, von denen nur ungefähr 350 ihren Weg zur Demonstration gefunden haben – wo waren denn die anderen? In einer internen Aussendung hieß es im Streikaufruf schließlich wie folgt: „STREIK bedeutet Anwesenheitspflicht an der Universität und Teilnahme an den anlässlich des Streikes stattfindenen Veranstaltungen“.
Aber gut, vielleicht taten es die Lehrenden den Studenten gleich, die gleich scharenweise ausblieben und sich über einen freien Tag freuten. Das süße Nichtstun beißt sich ja schließlich auch mit dem anstrengenden Herummarschieren in der regnerischen Stadt. Und obwohl ich es bezweifle, hat vielleicht der eine oder andere die Gesamtaktion auch schon vorweg als das interpretieren können, was sie letzten Endes war: Eine gemütliche Möglichkeit, das eigene Gewissen beruhigen zu können, man hätte ja etwas getan – oder es zumindest versucht.
Dabei haben sich die Beteiligten ja durchaus Mühe gegeben: In Mönchskutten gewandete Studenten, die sich, geprägt durch den übermäßigen Konsum von Monty-Python-Filmen, ein Unigesetz gegen den Kopf knallten, sorgten für bedeutungsschwangere Symbolik. Der nette Grüne von Nebenan, Ralph Schallmeiner, äußerte sich neben vielen anderen zum Gesetzesentwurf und klang dann nach anfänglich intelligenter Argumentation wie ein Händler auf dem Hamburger Fischmarkt, der seine Ware lauthals an den Mann bringen will. Unterhaltsamster Teil der Veranstaltung war zweifelsohne Maximilian Fussl, der sich als Moderator zu so mancher „Emotion aufregte“ und in brillianter Rhetorik humoristische Seitenhiebe und kritische Äußerungen verknüpfte.
Aber letzten Endes waren es ja unterschwellig doch nur gegenseitige Versicherungen, man stelle sich quer und lasse sich nichts gefallen. Nach der Veranstaltung ging man, in der sicheren Überzeugung, seiner Bürger-, Studenten-, Professoren- und generellen Äußerungspflicht nachgekommen zu sein, mit besänftigtem Gewissen zum Streikessen in den Rudolfskai. In einer abrundenden Streikversammlung durfte sich jeder Freiwillige dann noch zum Thema äußern.
Freilich ist es einfach, eine kritische Position angesichts des eher verhalten funktionierenden Streikprinzips einzunehmen, insbesondere im Hinblick auf den Mangel an vernünftigen Alternativen. Kern des Problems ist die Solidaritätsfrage: Wer einen Streik ausruft, sollte auch mitmachen. Wenn gestreikt wird, sollten nicht trotzdem verschiedenste Lehrveranstaltungen gehalten werden. Und: wenn demonstriert wird, sollte man sich nicht darauf verlassen, daß andere hingehen und die eigene Abwesenheit deshalb gar nicht auffällt.
Alles in allem hat uns der Streik eigentlich nur gezeigt, daß die Lage traurig ist: Der Mittelbau drängt die ÖH zur Mitorganisation eines Streikes und bleibt dann fern. Die Professorenschaft sieht ihre Position nicht gefährdet und braucht deswegen nicht für andere auf die Straße zu gehen. Und die Studenten leiden an der üblichen Krankheit: Apathie, dem „Überdruß an langweiligem Spektakel“, wie es Berufsdenker Hakim Bey einmal so schön formulierte. Zum Glück gibt es überall Ausnahmen, ansonsten hätten wir wohl tatsächlich nur zu siebt demonstriert.
„STREIK soll auch spürbar sein. Er soll bewußt machen, welche Auswirkungen es hat, wenn Arbeit ausgesetzt wird,“ heißt es in der oben zitierten Aussendung. Hat es jemand gespürt?
Dieser Artikel erschien ursprünglich in der Ausgabe Juni 2002 der Studentenzeitschrift Aktion. Man beachte, wie ein falsch gesetztes Fragezeichen (in der vierten Spalte: „… sollten nicht trotzdem verschiedenste Lehrveranstaltungen gehalten werden“) den Sinn des ursprünglichen Satzes umdreht.
——————
4 8 15 16 23 42